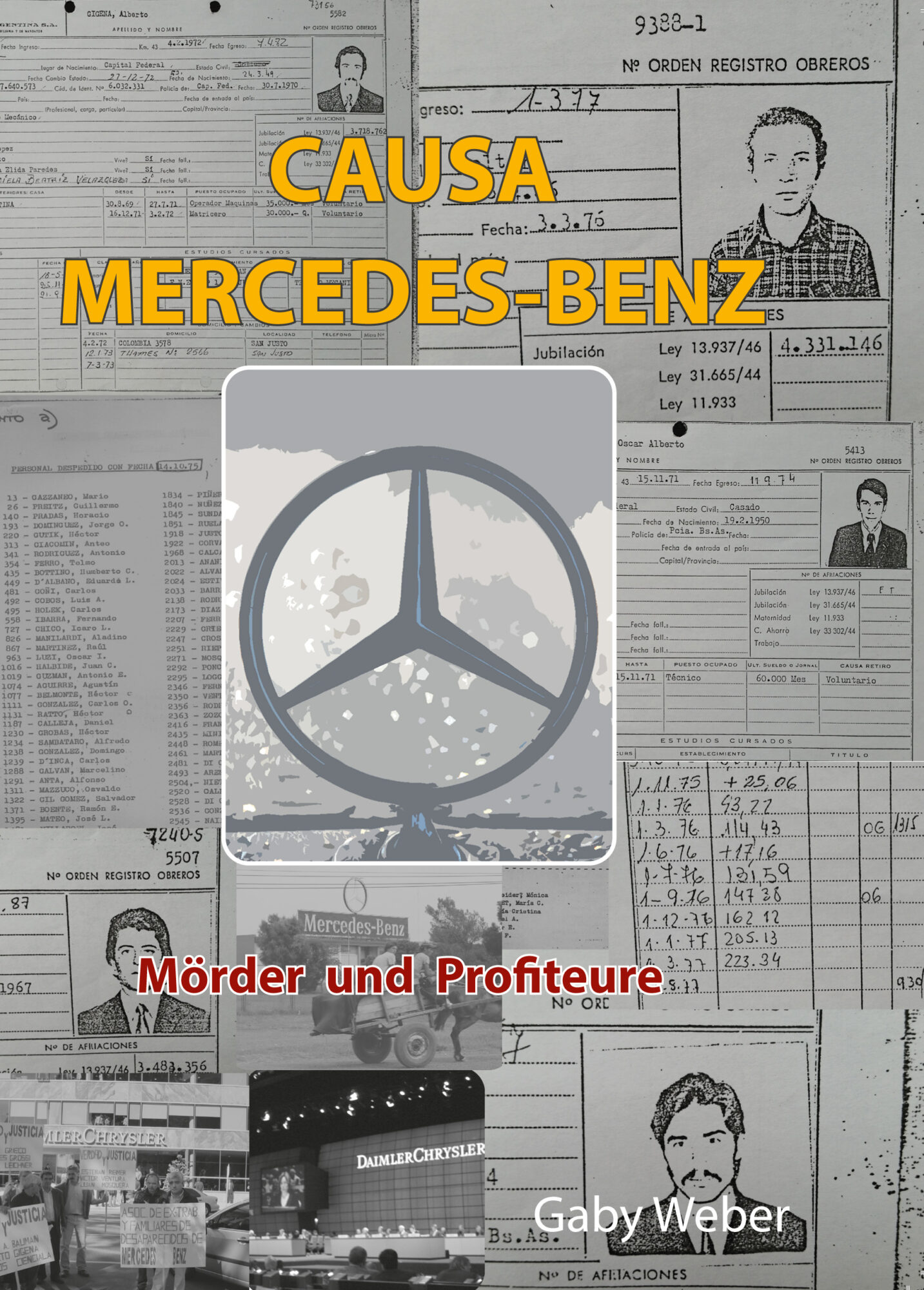von Eckart Dietzfelbinger* (Ver.di, Ortsverein Würzburg, Vortrag vom 7.11.2024)

“Seit den 1980er Jahren des 20. Jahrhunderts haben sich die politischen Achsen der meisten Industrieländer nach rechts verlagert. Die Mehrheit der westeuropäischen Staaten weist inzwischen einen erheblichen parlamentarisch vertretenen Anteil rechtsextremer oder Rechtsaußenparteien auf, die im Schnitt zwischen 12 und 14 Prozent der Stimmen bekommen.” Warum ist das so? Eine Analyse mit Rück- und Weitblick.
Begriffsklärung
Die Bestandteile rechtsextremer Ideologien sind Nationalismus, Rassismus, Sozialdarwinismus, die Ablehnung von Theorien und Ideen von links für eine sozial gerechtere Gesellschaft, Antikommunismus sowie Rassenantisemitismus. Menschen jüdischen Glaubens werden in der Regel für alle Probleme der Welt verantwortlich gemacht.
Das zentrale Element ist das Bild der Ungleichheit der Menschen. Die Zugehörigkeit zu einem Volk, einer Ethnie, Nation oder „Rasse“ entscheidet über den Wert von Menschen: ob er oder sie dazu gehören oder nicht. Sie seien deshalb nicht mit gleichen oder gar keinen Rechten zu versehen und entsprechend zu behandeln. Hier wurzelten die Ursachen von gesellschaftlichen Konflikten. Um sie zu unterbinden, müsse es in einem Staat autoritäre Führung und Gefolgschaft geben.
Die eigene Kultur und Geschichte gilt im Vergleich zu anderen als überlegen. Einflüsse und Berührungen fremder Kulturen und Religionen stellen eine Bedrohung dar und sind daher von der eigenen fernzuhalten.
Der Nationalsozialismus wird teils oder offen bejaht. Rechtsextremismus in klassischer Weise operiert immer mit Gewalt.
Die Umsetzung dieser Vorstellungen in Politikmodelle mit dem Entstehen des Faschismus nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in der internationalen Staatenwelt und ihre Ergebnisse sind bekannt: Autoritarismus, Diktatur (Führerprinzip), politische Re-pression, Terror, Kriege, Massenmord mit zig Millionen Toten, verbunden mit grenzenlosem Leid und Unglück für die davon betroffenen Menschen.
Zum Thema: Rechtsextremismus heute
Seit den 1980er Jahren des 20. Jahrhunderts haben sich die politischen Achsen der meisten Industrieländer nach rechts verlagert. Die Mehrheit der westeuropäischen Staaten weist inzwischen einen erheblichen parlamentarisch vertretenen Anteil rechtsextremer oder Rechtsaußenparteien auf, die im Schnitt zwischen 12 und 14 Prozent der Stimmen bekommen. Bei der Europawahl am 9. Juni 2024 haben sie fast ausnahmslos dazugewonnen. In Italien, Ungarn, der Slowakei, Kroatien, Finnland und den Niederlanden sind sie an der Regierung.
Im September 2024 wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die nationalradikale AfD in einem deutschen Bundesland, Thüringen, stärkste politische Kraft. In Sachsen und Brandenburg kam sie auf den zweiten Platz.
Die Hintergründe für diese Entwicklung liegen in den ökonomischen Veränderungen der letzten 30 Jahre, die unscharf und verkürzt mit dem Begriff „Globalisierung“ umschrieben werden. Die Prinzipien einer liberalen und sozialen Grundordnung haben den Westen nach 1945 wirtschaftlich groß werden lassen und politische Macht garantiert. Das Scheitern des staatlichen Kommunismus Ende der 1980er Jahre schien die endgültige Bestätigung für den Erfolg zu sein. Die Wirtschaftspolitik der Industriestaaten in den folgenden zwei Jahrzehnten war geprägt durch die Prinzipien des Neoliberalismus mit der verstärkten Anwendung von Politiken der Deregulierung – Ausschalten in der Wirtschaft geltender Regeln, Umwandlung von öffentlichen Dienstleistungen wie Bahn und Post in privates Eigentum (Privatisierung), der Durchsetzung des Freihandels, der Verringerung der Rolle des Staates bei Pflege und Erhalt der Infrastrukturen. So entstand ein autoritärer und entsicherter Kapitalismus, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen riesigen Kontrollgewinn verzeichnete, vor allem in Gestalt des globalen Finanzkapitalismus. Er drang in immer mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens vor, die noch nicht ökonomisiert waren. Nach Angaben der Weltbank ging die globale Armut von 1990 bis 2022 besonders wegen dem wachsenden Wohlstand in China und Indien deutlich zurück.[1]
Ein wesentliches Ziel neoliberaler Politik ist die Vereinheitlichung der sozialen Sicherungssysteme, um sie für die Wertschöpfung zugänglich zu machen. Die Folge war weltweit eine extreme Umverteilung zwischen arm und reich.
In der Bundesrepublik setzte diese Entwicklung noch unter der sozialliberalen Koalition Anfang der 1980er Jahre ein. Die rotgrüne Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) legte mit der „Agenda 2010“ ein Konzept zur Reform des deutschen Sozialsystems und Arbeitsmarktes vor, das in seinen Leitlinien eine Fortsetzung der Lissabon-Strategie der Europäischen Union (EU) von 2000 fand. Ihr Anliegen war es, im globalen Standortwettbewerb „die wettbewerbsstärkste Region der Welt“ (Lissabon-Agenda) zu werden. Damit wurde sie zum Vorreiter beim Abbau des Sozialstaates in den Mitgliedsländern.
Krisen und Radikalisierung
Die nationalstaatlichen Politiken erfuhren durch die neoliberale Wirtschaftspolitik riesige Kontrollverluste. Die Folgen waren und sind zahlreiche Krisen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie erstens die sicherheitsverbürgenden Routinen des Alltags und des Politikbetriebs gewissermaßen außer Kraft setzen. Zweitens lassen sich die Zustände vorher nicht mehr wiederherstellen.
Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und dem anschließenden „War on Terror“ gab es eine islamistisch-kulturelle Krise. In Bezug auf den Umgang mit Minderheiten in der westlichen Welt – wie Muslime – war das ein Wendepunkt.
2005/06 kam die Hartz-IV-Krise; 2008/09 eine globale Finanz- und Wirtschaftskrise, in der Staaten Geldinstitute mit Steuermitteln retten mussten. 2015 folgte besonders wegen der durch den Bürgerkrieg in Syrien ausgelösten Fluchtbewegung von Millionen Menschen die europaweite Flüchtlingskrise. 2019 breitete sich Corona aus. Im Verlauf der Pandemie kam es zu der weltweit größten Zuspitzung der sozialen Ungleichheit. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung verfügt seitdem über zwei Drittel des weltweiten Vermögenszuwachses, mit steigender Tendenz. Gleichzeitig gab es auf der Welt 100 Millionen Arme mehr.[2] Die von rechts vereinnahmten Coronaproteste gegen die von staatlicher Seite unternommenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ließ elitenfeindliche Milieus anschwellen.
Diese existenziellen Krisen bedeuten für viele Menschen soziale Desintegrationsprozesse, wachsende Unsicherheit und hinterlassen tiefe Kränkungen. Sie deformieren sie, für Teile der Bevölkerung entstehen daraus Kontrollverluste und Ängste. Empirisch nachweisbar besteht zwischen ihnen und dem Ansteigen von Verschwörungsideologien ein Zusammenhang, die deutlich gegen Vernunft und Aufklärung gerichtet und mit der brachialen Ausweitung von autoritären Mustern verbunden sind.
In der bisher weltweit einzigen Langzeitstudie „Deutsche Zustände“ zwischen 2002 und 2012, erstellt vom interdisziplinären Institut für Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) an der Universität Bielefeld mit seinem Direktor Wilhelm Heitmeyer, zeichneten sich die politischen Potenziale in den autoritären Einstellungen von Teilen der Bevölkerung in Deutschland bereits deutlich ab. Es konnte messen, dass sich insbesondere nach der Finanzkrise, zwischen 2009 und 2011, bereits vorhandene rechtspopulistische Einstellungsmuster nochmals deutlich radikalisiert haben.
Hinzu kommt, dass die globale Großwetterlage dem Trend nach rechts in die Hände spielt. Die durch den Zweiten Weltkrieg entstandene bipolare Weltordnung löste sich nach dem Epochenbruch mit dem Untergang der Sowjetunion 1989 auf. Sie wandelte sich mit dem zunehmenden Einfluss Chinas und anderer aufstrebender Mächte wie Saudi-Arabien zu einem multipolaren System (BRICS), die Vorherrschaft der USA schwindet. Das Ganze spiegelt sich in einem globalen Ordnungskonflikt zwischen liberalen Demokratien und autokratischen Regimen. Derzeit leben 39,4 % (+2,5 %) der Weltbevölkerung in einer Diktatur. 45,7 % (+0,04 %) in einer Demokratie, in einer vollständigen Demokratie jedoch nur 7,8 %.[3]
Ihre Institutionen sowie supranationale Organisationen, politische Stiftungen und internationale Wirtschaftsunternehmen, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen sehen sich mit steigender Tendenz Cyberangriffen staatlicher Akteure, ob Russland, Türkei, Iran, oder China ausgesetzt. Whistleblower wie Edward Snowden machten die Methoden der National Security Agency in den USA und ihre Zusammenarbeit mit Geheimdiensten verschiedener Länder bei der globalen Überwachung und Ausspionierung von Politikern und der Bevölkerungen bekannt. Dieses Vorgehen, auch als hybride Kriegführung bezeichnet, besteht aus einer Kombination regulärer und irregulärer politischer, wirtschaftlicher, medialer, subversiver, geheimdienstlicher, cybertechnischer und militärischer Kampfformen. Ziel der Angriffe ist es, das Vertrauen der Bevölkerung in die Stabilität und Handlungsfähigkeit der jeweiligen Regierung zu untergraben.
Die Beibehaltung der Orientierung an herkömmlichen Sicherheitsstrukturen – NATO und die Bundeswehr – besteht weiter, birgt unkalkulierbare Risiken: einen neuen Rüstungswettlauf, die Gefahr eines Dritten Weltkrieges und auch eines Atomkrieges. Ergebnis ist eine neue „unübersichtliche Friedlosigkeit“ im 21. Jahrhundert. 2023 starben in 59 Kriegen und Konflikten 153.702 Menschen, 114 Millionen Menschen wurden gewaltsam vertrieben und aus ihrem bisherigen Leben gerissen (Taz, 13.12.2023).[4]
Dazu trübt die apokalyptische Dimension der Erderhitzung die Perspektiven auf eine hoffnungsvollere Zukunft weiter ein. Die Meldungen und Bilder von jeweils noch nie dagewesenen Überflutungen, Bränden und Stürmen mit der Zerstörung von Millionen Existenzen gehören inzwischen zum Bestandteil der täglichen Nachrichten.
Rechtsextremismus in der Bundesrepublik
Der Mauerfall 1989 und die deutsche Wiedervereinigung 1990 führten zu einem enormen Anstieg von Rechtsextremismus. Versäumnisse der alten Bundesrepublik und der DDR betreffend einer Auseinandersetzung darüber verschränkten sich und eskalierten in bis dahin nie erreichtem Ausmaß. Die Ereignisse in Hoyerswerda (17. – 23. 9.1991), Hünxe (3.10.1991), Rostock-Lichtenhagen (22.- 26.8.1992), Mölln (23.11.1992) und Solingen (29.5.1993) in der ersten Hälfte der 1990er Jahre setzten in der Gewalt von rechts gegen Ausländer und Migranten Zäsuren. Protagonisten der Pogrome bauten rechtsextreme Strukturen, d.h. eine gewalttätige rechte Hegemonie in den Ost-Bundesländern in den sogenannten Baseballschlägerjahren, dem Aufstieg der NPD in den 2000er Jahren und der Neuerfindung des Rechtsextremismus im neurechten Gewand in den 2010er Jahren auf. Im Westen wurden dagegen länger bestehende rechte Milieus reaktiviert: Die damaligen Hochburgen rechtsextremer Parteien im Westen sind heute oft Hochburgen für die AfD. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz stieg die Zahl gewaltbereiter Rechtsextremer bis Ende 2000 um 52 % auf 9.700, ihre Gewalttaten auf mehr als 1000 pro Jahr.[5] Bis heute forderten sie mehr als 200 Menschenleben. Betroffen waren und sind sog. Ausländer, Aussiedler, Juden, Sinti, Roma, Behinderte, Akteure der LGBTQ-Bewegung, Linke und PolitikerInnen, die sich für Demokratie und Rechtsstaat engagieren.
Neue Rechte
Im Mai 2000 gründeten Götz Kubitschek, Karlheinz Weißmann und weitere Mitglieder aus dem Umfeld der neurechten Wochenzeitung Jungen Freiheit das Institut für Staatspolitik (IfS) als Denkfabrik der Neuen Rechten mit Sitz in Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Es versteht sich als ihr prägender Ideen- und Impulsgeber. Eine davon ist die Erzählung vom „Großen Austausch“, womit ein angeblicher Plan gemeint ist, die „weißen“ Mehrheitsbevölkerungen gegen muslimische und „nicht weiße“ Einwanderer auszutauschen (Ethnopluralismus). Die Veranstaltungen des IfS werden von Personen aus einem breiten Spektrum neurechter Politik besucht, darunter auch Funktionsträger und Aktivisten der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) sowie der Identitären Bewegung IB. Im Mai 2024 löste sich das IfS auf und setzt seine Arbeit unter neuen Namen – Nachfolgeorganisationen firmieren unter den Namen Menschenpark Veranstaltungs UG und Metapolitik Verlags UG – fort .[6]
Eine Zäsur für den Rechtsextremismus in der Bundesrepublik bedeutete das 2010 von dem früheren Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) verfasste Buch „Deutschland schafft sich ab“ vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Finanzkrise und der deutlich ansteigenden Islamophobie. Die wichtigsten Sündenböcke stehen dabei fest: Es sind die Muslime. Sarrazin argumentierte darin biologistisch, unterstellte ihnen z.B. niedrigere Intelligenzquotienten und kombinierte das Ganze mit neoliberalen Botschaften. Das Buch avancierte zum Bestseller und wurde millionenfach verkauft. Bei den öffentlichen Veranstaltungen ließ sich das Ausbrechen einer „rohen Bürgerlichkeit“ (W. Heitmeyer) gerade der mittleren bis höheren Schichten der Gesellschaft mit Beifallsstürmen für Sarrazin beobachten: die Aufkündigung der Solidarität mit den unteren Klassen und der rigorosen Verteidigung bzw. Einforderung eigener Etabliertenvorrechte.
Im Oktober 2014 fand diese Stimmung auf der politischen und gesellschaftlichen Bühne in Gestalt der Organisation „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“(Pegida) in Dresden Ausdruck. Daraus entstand eine rechtspopulistische Massenbewegung mit einem vagabundierenden Autoritarismus in Teilen der Bevölkerung, die in den nächsten beiden Jahren zeitweise mehr als 15.000 Personen auf die Straße brachte, Ableger davon bildeten sich in weiteren Städten. Die Zusammenarbeit mit etablierten Medien wurde meist verweigert unter dem Stichwort „Lügenpresse“. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten kam es in größerem Umfang zu Tätlichkeiten gegenüber Pressevertretern.
Rechtsterrorismus
Dazu kommt der Rechtsterrorismus, der in Deutschland eine lange Geschichte hat. Zentraler Bestandteil von Ideologie, Propaganda und Taten ist der Hass auf Juden und Ausländer mit dem Ziel, sie zu diffamieren und auszulöschen.
Der Bombenanschlag am Bahnhof Düsseldorf Wehrhahn (27.7.) 2000 gegen zehn MigrantInnen, von denen einige lebensgefährlich verletzt wurden; die Mordserie des NSU von 2000 bis 2007, die mindestens 10 Menschen das Leben kostete, flankiert von Raubüberfällen und Sprengstoffanschlägen, bei denen weitere Menschen teils schwer verletzt wurden; im Oktober 2015 das Attentat auf die parteilose Politikerin Henriette Reker einen Tag vor ihrer Wahl zur Kölner Oberbürgermeisterin, dass sie nur durch eine Notoperation überlebte; die Anschläge im Olympia-Einkaufszentrum München 2016; der Mord an dem Regierungspräsidenten von Kassel Walter Lübcke im Juni 2019, weil er sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte; im gleichen Jahr auf die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur; Hanau 2020, die mehr als 20 Menschen, die meisten mit Migrationsgeschichte das Leben kosteten, dazu mehrere Verletzte; sowie einige noch rechtzeitig aufgedeckte Gewalttaten sind eine alarmierende Bilanz.
Bei der Strafverfolgung von Rechtsterroristen offenbarten die Sicherheitsbehörden jahrzehntelang einen Mangel an historischem Orientierungswissen, deren Taten im Kontext gesellschaftlicher Verhältnisse zu begreifen und sie effektiv zu bekämpfen. Zu wünschen bleibt, dass bei den laufenden Prozessen in Stuttgart, Frankfurt/M. und München gegen etwa 50 Personen aus der Reichsbürgerszene, denen die Vorbereitung eines terroristischen Staatsstreiches zur Last gelegt wird, hier ein dementsprechender Blick einen Platz findet. Denn deren Angehörigkeit reicht von der Bundeswehr über AfD-Splitter bis zum Adel, also quer durch die Gesellschaft. Sicherheitsbehörden schätzen die Zahl der Angehörigen der Szene auf 25.000. Ein Zehntel davon, etwa 2.500 Personen, gilt als gewaltorientiert.[7]
Der rechte Terror aber beginnt nicht erst, wenn zugeschlagen wird. Er beginnt, wenn Menschen ihr Leben aus Angst umstellen, sich überlegen müssen, wie sie sich schützen vor Hassposts und Drohungen, eingeworfenen Scheiben, Zerstörungen von Pkws und tätlichen Angriffen. Im Februar 2024 offenbarte das kommunale Monitoring zu Hass, Hetze und Gewalt gegenüber Amtsträgerinnen und Amtsträgern (KoMo)[8], dass 38 Prozent der befragten OberbürgermeisterInnen und LandrätInnen Anfeindungen erleben mussten. Politischer Hauptfeind sind die Grünen. Erinnert sei an die Bauernproteste gegen die Streichung des Rabatts bei der Energiesteuer auf Agrardiesel durch die Bundesregierung. Auf Plakaten stand da z.B.: „Tötet Özdemir; „Eure Demokratie ist unser Volkstod“. Die Bedrohungsallianz umfasst Einzelpersonen, die Einstellungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit teilen, sowie ein Milieu von Bewegungen und Parteien, die autoritär-nationalradikal“ ausgerichtet sind, als auch Zellen und Unterstützende, die terroristisch und klandestin agieren. Dementsprechend stiegen die rechtsextrem motivierten Straftaten 2023 erneut an, auf 28.945 Fälle. Die Gewalttaten auf 1.270 Fälle; insgesamt waren es über 41.640 Straf- und Gewalttaten.[9] Ebenso haben antisemitische Vorfälle in der Bundesrepublik insbesondere seit dem Angriff der Terrororganisation HAMAS auf Israel am 7. Oktober 2023 stark zugenommen. Bis zum Jahresende 2023 registrierte das Bundeskriminalamt (BKA) mehr als 1.100.
AfD
Der Neuen Rechten schwebte als Ideallösung zur Erreichung ihrer politischen Ziele eine eigene, dezidiert rechte Partei nach dem Vorbild der österreichischen FPÖ vor. Ihre Gründung erfolgte im Februar 2013 in Oberursel mit der „Alternative für Deutschland“ als EU-skeptische und rechtsliberale Partei. Der Parteiname bezog sich auf eine Äußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, wonach die Eurorettung „alternativlos“ sei.
Bei der Bundestagswahl 2013 erreichte die AfD mit 4,7 Prozent ein beachtliches Ergebnis. Bei der Europawahl 2014 gelang ihr mit 7,1 % der Einzug in ein überregionales Parlament. Damit avancierte sie zum parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik.
Die sog. „Flüchtlingskrise“ in Europa war 2015 – die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel entschied Anfang September, die über die Balkanroute kommenden und in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge aufzunehmen, worauf 2015 und 2016 über eine Million Flüchtlinge, Migranten und andere Schutzsuchenden nach Deutschland einreisten – war für die AfD ein „Geschenk des Himmels“, so Alexander Gauland, früherer AfD-Bundessprecher und mehrere Jahre Mitglied im Vorstand. Die AfD instrumentalisierte das Thema für ihre Politik und heizte es in immer neuen Varianten in Verbindung mit Kriminalität gekonnt auf. Unter der Regie von Björn Höcke und Co. radikalisierte sich die Partei mit dem „Flügel“/Erfurter Resolution und bietet seitdem sowohl für Menschen mit rechtspopulistischen als auch für welche mit rechtsextremen Einstellungen eine Plattform.
Ihre Agitation setzt an den bereits vorhandenen Gefühlen des Unbehagens bei vielen Menschen an. Der entscheidende Trick besteht darin, dieses teils noch unartikulierte Unbehagen nicht in ein bearbeitbares Sachproblem zu überführen, sondern es mit vorhandenen Ressentiments zu verknüpfen. Höcke geht zum Beispiel mit der Rhetorik vom Untergang des deutschen Volkes hausieren, um Ängste zu erzeugen. Mit dieser Untergangsrhetorik lässt sich gleichzeitig für bestimmte Gruppen aus dem rechten und neonazistischen Lager eine Notwehrsituation konstruieren, die auch Gewalt legitimiert gegen markierte Gruppen. Die AfD baut mit ihren Parolen Legitimationsbrücken für Gewalt – ohne selbst tätig zu werden. Zur gewaltbereiten Neonaziszene hat die AfD im Unterschied zur NPD keine systematische Verbindungen. Für Wilhelm Heitmeyer vertritt sie einen autoritären Nationalradikalismus. Das ist eigentlich ihre Erfolgsspur. Sie will darauf hinaus, dass ihr Verständnis autoritärer nationalistischer und radikaler Politik sich normalisiert in Institutionen wie Justiz, Medien, Kultureinrichtungen, in die Schulen. Und alles, was als normal gilt, kann man zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr problematisieren. Ihr zentrales Ziel ist ein Systemwechsel von innen. Daraus entsteht tatsächlich die Bedrohung für die parlamentarische Demokratie.
Der Erfolg der AfD beruht auch wesentlich auf der sehr geschickten und rabiaten politischen Kommunikationsstrategie. Sie ist die modernste Digitalpartei, die um sich herum längst eine eigene Medienwelt geschaffen hat. Die etablierten Parteien hinken da weit hinterher.
Ende Februar 2021 stufte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die Gesamtpartei als rechtsextremen Verdachtsfall ein, um sie bundesweit auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten zu können. Die Hochstufung als gesichert rechtsextremistisch dürfte folgen; sie wäre die Voraussetzung für ein Verbotsverfahren, der politische und juristische Streit darum hält an.
Extremismus der Mitte
Kennzeichnend für die Rechtsverlagerung in den meisten Industrieländern ist die Radikalisierung ganzer Bereiche der früheren politischen Mitte: Liberale, Christdemokraten, Konservative. Dazu gibt es auch die Theorie bzw. den Fachbegriff vom „Extremismus der Mitte“.
Um nur ein Beispiel in Erinnerung zu rufen:
1993 höhlte die regierende CDU mit den Stimmen der SPD-Opposition unter dem Druck der Zahl der Antragsteller auf Asyl nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion – es waren mehr als 400.000 – Artikel 16 GG, der politisch Verfolgten in der Bundesrepublik Schutz zusichert, aus. Weil es die Politik versäumt bzw. herausgeschoben hatte, ein Staatsangehörigkeitsrecht und Zuwanderungsgesetz zu schaffen, kompensierte sie das mit der Einschränkung eines für verfolgte Menschen existentiellen Rechts. Kein Flüchtling hat seit der Änderung mehr eine Chance auf politisches Asyl in Deutschland, wer aus „verfolgungsfreien“ Ländern stammt oder über „sichere Drittstaaten“ einreist (Drittstaatenregelung). Damit erfüllte die Politik den Willen des damals tobenden braunen Mobs. Zahlreiche Opfer rechter Gewalt wurden aufgrund des beschnittenen Asylgesetzes des Landes verwiesen.
Und 2024? Nach den Messerattacken eines Afghanen in Mannheim mit einem toten Polizisten im Juni und eines Syrers in Solingen im August mit drei Toten und mehreren Verletzten, nach den drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg mit den genannten Ergebnissen für die AfD erweckt die Debatte zur Migration, angeführt von Union und FDP, vielen Medien, zuletzt auch von SPD und Bundespräsident Walter Steinmeier den Eindruck, die Aufnahme von Flüchtlingen sei derzeit das größte Problem und die BRD stehe kurz vor dem Kollaps. Mit diskursiven Tiefpunkten, z.B. dass Asylbewerbern den Deutschen die Zahnarzttermine wegnähmen, so der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Im Oktober 2023 diskutierte die Ministerpräsidenten-Konferenz über eine Arbeitspflicht für Asylsuchende, die mit den Prinzipien eines liberalen Rechtsstaats nicht zu vereinbaren ist.
Die Europäische Union schottet sich an ihren Außengrenzen seit der Jahrtausendwende zunehmend gegen Flüchtlinge mit restriktiven und repressiven Mitteln ab (Schengener Abkommen). Mit der Kriminalisierung von Seenotrettung, dem Versperren von Häfen für Schiffe, die Flüchtlinge vor dem Ertrinken gerettet haben, und weiteren Maßnahmen versucht die europäische Migrationspolitik den humanitären Korridor zu schließen. Seit 2014 sind mehr als 30.000 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken. Die für den Schutz der europäischen Grenzen zuständige Europäische Agentur Frontex hat wiederholt gegen Flüchtlings- und gegen Menschenrechte auf See verstoßen (Pushbacks u.a.) und macht das weiterhin. Die Politik mit dem zerfallenden Staat Libyen betreffend des Umgangs mit Flüchtlingen oder mit Tunesien ist katastrophal. Nicht einmal einen verbindlichen Verteilmechanismus von Flüchtlingen in den 27 Mitgliedstaaten hat die EU bis jetzt hinbekommen. Mit von ihr finanzierten Sicherheitskräften in Nordafrika betreibt sie eine tödliche Flüchtlingspolitik, wie jüngste Reportagen über die Aussetzung von Flüchtlingen in der Wüste ohne Nahrung und Wasser dokumentieren.[10] Das Ganze ist ein Skandal und ein zutiefst beschämendes Kapitel von Inhumanität.
Die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als „Historische Einigung“ bezeichnete Reform des Gemeinsames Europäisches Asylsystem (Geas), die im Mai 2024 vom Rat der EU und dem Europäischen Parlament beschlossen wurde und 2026 in Kraft treten soll, lässt befürchten, dass alle menschenrechtlichen roten Linien eingerissen werden. Es wurden so viele Ausnahmetatbestände in den Regeln hineinverhandelt, dass Willkür nur wenige Schranken finden wird.
Migration: eine Debatte jenseits der Menschlichkeit
In der aufgeheizten Debatte ist der Begriff „irreguläre Migration“, die über das Mittelmeer und an den Grenzen gestoppt werden müsse, mantraartig jeden Tag zu hören.
Gestatten Sie mir deshalb zu den Themen Asyl und Migration ein paar grundsätzliche Anmerkungen.
Nach den Erfahrungen des frühen 20. Jahrhunderts mit zwei Weltkriegen, zig Millionen Toten und Flüchtlingen wurde im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Art. 1 des GG der Schutz der menschlichen Würde als Auftrag aller staatlichen Gewalt definiert. In Art. 16 wurde das Asylrecht für politisch verfolgte Menschen als einklagbares Individualrecht festgeschrieben und damit die Konsequenz aus den Menschenrechtsverletzungen der Nationalsozialisten gezogen.
In der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) aus dem Jahr 1951 verpflichteten sich die Vertragsstaaten – darunter auch die Bundesrepublik Deutschland – zur Gewährung von Asyl und zur Einhaltung eines so genannten Mindestschutzstandards. In der Charta der Grundrechte der EU von 2000 und im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist das nochmals ausdrücklich verankert worden.
Das heißt, sobald Menschen, die wegen ihrer Ethnie, Religion, als kulturelle Gruppe oder politischen Gründen verfolgt werden, die EU erreichen, haben sie das Recht Asyl zu beantragen und dürfen nicht einfach abgewiesen werden.
„Irreguläre Migration“ gibt es nicht. In Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskonvention ist geregelt, dass fliehende Menschen nicht wegen einer unerlaubten Einreise bestraft werden dürfen. Damit ist sie auch keine Straftat. Grundsätzlich ist kein Mensch illegal. Somit geht es um nicht autorisierte Grenzübertritte. Die überwiegende Mehrheit aller AntragstellerInnen auf Asyl musste auf diese Weise einreisen. Denn die „legalen Wege“ existieren de facto nicht.
Auf europäischer Ebene gibt es relativ hohe Anerkennungsquoten. Das heißt, ein beträchtlicher Anteil dieser Menschen bekommt einen berechtigten Schutzstatus zuge-sprochen. In Deutschland lag die Anerkennungsquote 2023 bei 52 %.
Die Bundesrepublik – das gilt für alle Länder der Europäischen Union – ist längst ein modernes Einwanderungsland. Im Jahr 2019 hatten 21,2 Millionen der insgesamt 81,8 Millionen Einwohner in Deutschland einen Migrationshintergrund (Zugewanderte und ihre Nachkommen) – das entspricht einem Anteil von 26 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Von einer Masseneinwanderung in die Bundesrepublik und in die EU durch immer mehr Flüchtlinge kann nicht die Rede sein. 2023 gab es in Deutschland rund 1,93 Millionen Zuzüge und 1,27 Millionen Fortzüge (Nettozuwanderung 663 000 Personen). Ende 2023 beschrieben knapp 60 Prozent der befragten Kommunen betreffend der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten, zu der sie gesetzlich verpflichtet sind, die Lage als „herausfordernd, aber (noch) machbar“.[11] Existierende Engpässe sind weniger eine Frage der Zahl an Geflüchteten oder Zugewanderten, sondern liegt an Versäumnissen der Politik, langfristige Strukturen dafür zu schaffen.
Für die Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten gilt ein ähnlicher Befund. Sie zählt 446,7 Millionen Menschen. Der Anteil der in der EU registrierten Flüchtlinge liegt bei 1,5 % der Gesamtbevölkerung.[12] Die Zahl der Asyl-Erstanträge für 2023 betrug1.048.830.[13]
Das eigentliche Integrationsproblem auf dem Kontinent ist die oft unverschuldete, aber lebenslang wirkende Benachteiligung der Zuwandererbevölkerung in Bildung, Ausbildung und beruflicher Qualifikation bzw. Weiterqualifikation. Migrations-, Integrations- und Kulturpolitik bilden, miteinander verschränkt, gesellschaftspolitische Schlüsselaufgaben. Bei sinkenden Geburtenraten und demographischer Alterung wird die EU auch in den kommenden Jahrzehnten auf geregelte – und das heißt bei starkem „Migrationsdruck“ immer auch begrenzte – Zuwanderung von außen sowie auf nachhaltige Reformen im Innern angewiesen bleiben, um die ökonomischen und sozialen Folgen der tiefgreifenden demographischen Veränderungen etwas abzufedern. Einwanderung aber ist ein Prozess auf Gegenseitigkeit, der beide Seiten verändert. Entscheidend ist auch: Es kann sich nur um Integrationsangebote handeln. Zuwanderer werden nicht integriert, sondern integrieren sich selbst.
Fazit und Ausblick
Rechtsextremismus ist ein gesellschaftliches Problem. Seine Attraktivität und sein Erstarken im 21. Jahrhundert lassen sich nicht allein aus dem politischen System heraus erklären. Dazu gehört die jeweilige Vorgeschichte. Der manifeste Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und regionale Separatismus in Europa haben sich bereits um die letzte Jahrtausendwende deutlich abgezeichnet — sie wurden aber nicht besonders interessiert wahrgenommen, sondern ignoriert und verharmlost.
Die Politik hat zur Bekämpfung des Rechtsextremismus bisher kein wirksames Konzept entwickelt. Stattdessen soll eine restriktive Migrationspolitik quasi als Allheilmittel herhalten für teilweise schon seit Jahren und Jahrzehnten veranlagte Problemlagen, die sich in einer offenen pluralistischen Einwanderungsgesellschaft stellen und deren Lösungen eigentlich in ganz anderen politischen Bereichen zu suchen wären. Das betrifft die Bildungs-, Gesundheits-, Wohnungs-, die Sozial-, die Wirtschaftspolitik. Auch der demo-graphische Wandel im Hintergrund ist ein riesiges Thema. All das wird sich nicht allein durch Grenzschließungen, Abschottung und die Ethnisierung struktureller Problemlagen und der damit verbundenen pauschalen Abwertung von Flüchtlingen lösen lassen. Solche und weitere Ideen – mehr Abschiebungen, Kürzung von Sachleistungen, Ausweitung der Liste angeblich „sicherer Herkunftsländer“ – stehen alle im Wahlprogramm der AfD. Die braucht nur zuzusehen, wie ihre Forderungen durch den Extremismus der Mitte exekutiert werden. Das ist völlig widersinnig und zerstört die Demokratie. Asylsuchende und Geflüchtete haben weder den Strukturwandel noch die Globalisierung ausgelöst. Die „Flüchtlingskrise“ 2015 ist nicht die Ursache für die europaweit anhaltende Rechtsverlagerung, sondern lediglich der Auslöser, ein Katalysator.
Gleiches gilt für die unsägliche Sozialmissbrauchsdebatte. Die aggressiven Narrative gegen migrantische BürgergeldempfängerInnen gründen auf Veränderungen, die teilweise nichts mit ihnen zu tun haben. Bedingt durch Corona, in der auch kleine Selbständige plötzlich zu solchen wurden, erleichterte die Regierung die Zugangsbedingungen für Hartz IV, milderte Sanktionen ab und erweiterte die Formel für die jährliche Anpassung der Regelsätze im dann neuen „Bürgergeld“. Jetzt erscheint das durch den Extremismus der Mitte als zu üppig.
An konstruktiven Ansätzen und Vorschlägen, die Flüchtlings- und Migrationspolitik nach den in der EU rechtsverbindlichen Regeln auszurichten, würde es nicht fehlen. Z.B mit einem neuen Angebot an die Türkei, gemeinsam mit Griechenland, um die Zahl der Menschen, die aus der Türkei ohne autorisierten Grenzübertritt in die EU kommen, durch Rückführungen zu reduzieren, aber nicht durch Pushbacks und Gewalt. Oder die Durchführung von Asylverfahren für jene, die zurückgeschickt werden, durch das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR). Oder Abkommen mit Herkunftsstaaten in Westafrika wie Gambia und Nigeria, um kontrollierte Migrationskanäle in den Arbeitsmarkt mit Kontingenten am besten auf europäischer Ebene zu ermöglichen. Dazu gehört die Verstärkung der Seenotrettung im Mittelmeer. Und die Entwicklung einer Vision auf internationaler Ebene für ein neues globales Schutzsystem für Flüchtlinge und ein aktiveres UNHCR, das sich dafür einsetzt, dass es weltweit mehr sichere Staaten für Flüchtlinge gibt.
Gegenmaßnahmen gegen Rechtsextremismus
Wirksame Gegenmaßnahmen gegen die politische und gesellschaftliche Rechtsverlagerung können und müssen längerfristig angelegt werden. Schnelle Lösungen gibt es nicht, und schon gar nicht einen Königsweg:
– Aufgabe der Politik in Deutschland wäre es vor allem, Alternativen zur Attraktivität des Autoritären zu bieten. Es fehlt eine zuversichtliche Vision. Zum Beispiel mit einer offensiven Strategie der politischen Verteidigung eines starken Wohlfahrtsstaates – als institutioneller Garant der Lebenschancen und Bürgerrechte für diejenigen, die besonderes von den unmittelbaren und mittelbaren Kriseneffekten betroffen sein werden. Die weitverbreitete Angst der Mitte der Gesellschaft vor sozialem Abstieg sollte eingestanden und Ursachen dafür diskutiert werden. Dazu gehört auch Selbstreflexion in Bezug auf die eigene Politik, die möglicherweise dazu führt, dass solche extremen Positionen zustimmungsfähig werden.
– Eine der zentralen Aufgaben wäre die Stärkung gesellschaftlicher und staatlicher Institutionen, um sie vor einer Kaperung mittels rechtsgesinnter Personalpolitik zu schützen. Es ist wichtig, dass Menschen in den Institutionen sehr viel konfliktfähiger agieren, um eine weitere Ausbreitung und Normalisierung von rechtem Gedankengut zu verhindern. Schulische und außerschulische Bildungsarbeit müssen zu den Stützen im Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und Jugendgewalt gehören. Die Auseinandersetzung darüber sollte Teil der Lehrkräfteaus- und -fortbildung in allen Fächern werden.
– Erforderlich ist ebenso eine Stärkung der Zivilgesellschaft. Die großen Demonstrationen wie zu Jahressanfang gegen die durch das Treffen von Rechtsextremen in Potsdam bekanntgeworden Pläne zur Remigration sind bedeutsam, aber ihre Frequenz lässt sich nicht lange aufrechterhalten. Wichtig wäre es deshalb, sich stark zu machen in den nahen sozialen Bezugsgruppen. In der Verwandtschaft, im Freundeskreis, in der Familie, dem Sportverein. Man sollte bei aufkommenden Hetzsprüchen sofort einschreiten, um wenigstens die Normalisierung zu verhindern.
– Die Repräsentationslücken der etablierten Parteien in ländlichen und kleinstädtischen Räumen wären zu schließen. Die Bevölkerung dort ist zu einem großen Teil gar nicht mehr wahrgenommen worden. Und wer nicht wahrgenommen wird, ist ein Nichts. Hier fruchtet dann eine weitere AfD-Parole: Wir machen euch wieder sichtbar“.
Diese angedachten Maßnahmen erfordern allerdings den politischen Willen dafür, sowie Zeit und Rahmenbedingungen, die entsprechend zu fördern wären.
Erfolgen diese Maßnahmen jedoch nicht, dann ist in der Bundesrepublik für die nächsten Jahre ein konstant hohes Niveau an entsprechenden Wahlergebnissen für rechte Parteien und rechtsextrem motivierter Gewalt zu erwarten. Neue Opfer werden zu beklagen sein.
Dem braunen Ungeist entschieden entgegenzutreten, ist eine Daueraufgabe für Staat und Gesellschaft geworden. In diesem Sinn wünsche ich den Veranstaltern und Initiativen hier in Würzburg viel Erfolg und einen langen Atem.
*Dr. Eckart Dietzfelbinger – Jg. 1953, promovierter Politologe (1984) nach Studium der Geschichte, Sozialkunde und Germanistik. 1986-94 Mitarbeit am Pädagogischen Institut der Stadt Nürnberg, organisatorische und wissenschaftliche Betreuung der Ausstellung »Faszination und Gewalt – Nürnberg und der Nationalsozialismus« in der Zeppelintribüne des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes. Langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg.
[1] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1356924/umfrage/globale-armut-anzahl-der-armen-menschen (Zugriff 20.02.2025)
[2] Weltbankbericht Oktober 2021
https://www.kindernothilfe.at/informieren/aktuelles/im-fokus/2022/corona-pandemie-weitere-100-millionen-menschen-in-der-armut (Zugriff 14.2.2025)
[3] Zeit online, 15.2.2024
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2024-02/demokratie-economist-index-studie (Zugriff 14.2.2025)
[4] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1112076/umfrage/anzahl-aller-kriege-und-konflikte-weltweit (Zugriff 6.11.2024)
[5] Verfassungsschutzbericht 2001, S. 33
[6] https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/hintergruende/DE/rechtsextremismus/das-netzwerk-der-neuen-rechten.html#doc1755240bodyText2 (Zugriff 6.11.2024)
[7] taz 12.2022; VB 2023, S. 133
[8] www.motra.info/radikalisierungsmonitoring/kommunalmonitoring (Zugriff 18.02.2025)
[9] Taz, 11.- 17.5.2024
[10] BR Fernsehen, 1.11.2024: Ausgesetzt in der Wüste · Europas tödliche Flüchtlingspolitik. Die Dokumentation beleuchtet die dramatischen Folgen europäischer Flüchtlingspolitik, zeigt exklusiv, wie EU-finanzierte Sicherheitskräfte in Nordafrika systematisch Menschen in die Wüste verschleppen und welche Verantwortung Europas Regierungen tragen. https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNjaGVkdWxlU2xvdC83MzgxZjc4ZS0zZmJiLTRiZWUtODA4OS0xY2FhMTkxMGQ4ZTg (Zugriff 6.11.2024)
[11] https://mediendienst-integration.de/artikel/fuer-60-prozent-der-kommunen-aufnahme-noch-machbar.html (Zugriff 18.02.205)
[12] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_de (Zugriff 6.11.2024)
[13] https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-Soziales/Bevoelkerung/EUAsylantraege.html (Zugriff 6.11.2024)
 Medien | Meinungen Der Blog des Instituts für Medienverantwortung
Medien | Meinungen Der Blog des Instituts für Medienverantwortung